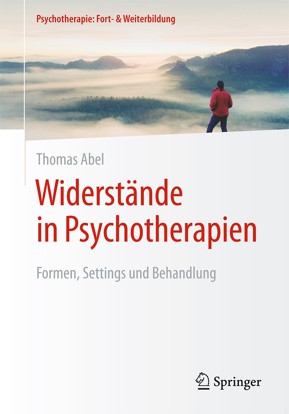Thomas Abel: Widerstände in Psychotherapien
Formen, Settings und Behandlung
- erschienen bei SPRINGER NATURE am 27.6.2025.194 Seiten, Druckausgabe: € (D) 29,99 | € (A) 30,83 | CHF 33.50; eBook: € 22,99 | CHF 26.50
- PatientInnen begeben sich in eine Psychotherapie, weil sie unter quälenden Symptomen oder Beziehungsproblemen leiden und daran etwas ändern möchten. Gleichzeitig sind Veränderungen vom ersten Schritt an beängstigend: zum einen stellen sie das zumeist mühsam gefundene psychische Gleichgewicht in Frage. Zum anderen liegen viele Abgründe, die auf dem Entwicklungsweg von den Patientinnen bewältigt werden müssen, noch im Nebel. Deshalb setzen sie dem therapeutischen Veränderungsprozess von Anfang an diverse Widerstände entgegen. Dieses Fachbuch zeigt auf, welche Konzepte einzelneTherapieverfahren vom Widerstand haben und was Widerstand in der psychotherapeutischen aber auch somatischen Behandlung bedeutet (Compliance). Die acht Formen des Widerstandes, die die Psychoanalyse unterscheidet, werden ausführlich anhand von Fallvignetten dargestellt. Verdeutlicht wird, warum in psychodynamischen Therapien die Regel gilt: “Widerstandsbearbeitung vor Inhaltsbearbeitung” und warum Therapien aller Richtungen an einem nicht verstandenen und nicht bearbeiteten Widerstand scheitern können.
- Direkt beim Verlag, aber auch bei Amazon Kindle, oder Apples Bücher-App können Sie das Ebook kaufen,.
- The English version of the book was published on January 29, 2026 in the USA by Springer Nature:
Thomas Abel: Resistance in Psychotherapy
The Eight Forms – Clinical Approaches and Meaning in the Therapeutic Process
Videos und Audios der Vortragsreihe von Thomas Abel: “Widerstände in Psychotherapien”
- Beim Auditorium-Verlag gibt es ein Set der fünfteiligen Vortragsreihe vom 10. September 2025 bis 07. Januar 2026, ca. 537 Min. auf 2 MP3-CDs oder 5 DVDs oder USB-Stick (video) oder als Sofortdownload (701 MB audio, 9,8 GB video)
- Die Zoom-Vortragsreihe zeigte auf, welche Konzepte einzelne Therapieverfahren vom Widerstand haben und was Widerstand in der psychotherapeutischen aber auch somatischen Behandlung bedeutet (Compliance). Die acht Formen des Widerstandes, die die Psychoanalyse unterscheidet, wurden ausführlich anhand von Fallvignetten dargestellt. Erkennbar wird, warum in psychodynamischen Therapien die Regel gilt: “Widerstandsbearbeitung vor Inhaltsbearbeitung” und warum Therapien aller Richtungen an einem nicht verstandenen und nicht bearbeiteten Widerstand scheitern können.
| Datum | Thema | Zuhörende |
|---|---|---|
| 10.09.2025 | Compliance, Prävalenz und Verteilung psychischer Krankheiten, Wirksamkeit von Psychotherapieverfahren, Versorgungslage mit Therapeutinnen, Entstehung und Entwicklung des Begriffes Widerstand, Formen des Widerstandes | 431 |
| 08.10.2025 | äußere und innere Rahmenwiderstände | 417 |
| 05.11.2025 | Widerstände durch Abwehrmechanismen | 465 |
| 03.12.2025 | Übertragungswiderstände, Schuld und Scham als Über-Ich-und Ich-Ideal-Widerstände, das Altgewohnte als Es-Widerstand | 403 |
| 07.01.2026 | Krankheitsgewinne, strukturspezifische Widerstände, Gegenübertragungswiderstände | 409 |
Handbuch der Objektbeziehungspsychologie
- Im September 2023 erschien im Psychosozial-Verlag das “Handbuch der Objektbeziehungspsychologie”, das ich herausgegeben habe. Otto F. Kernberg widmete dem Buch ein Geleitwort. Im Juli 2025 erschien bereits die 2. Auflage. Das Buch hat 520 Seiten und kostet 59,90€ (D), 61,60€ (A)
- Es enthält Beiträge von Thomas Abel, Marion Braun, Felix Brauner, Almuth Bruder-Bezzel, Ralph Butzer, Peter Conzen, Anna Katharina Dembler, Rainer Funk, Nikolas Heim, Ludwig Janus, Werner Köpp, Daina Langner, Ulrike Mensen, Tanja Ostapowicz, Ricarda Ostermann, Doreen Röseler, Franziska Schmeja, Bettina Schötz, Hermann Staats, Jens Tiedemann, Aleš Vápenka und Hans-Jürgen Wirth.
- Bisher gibt es das Buch nur in deutscher Sprache. In Planung ist, dass es in englisch in den USA erscheint, sowie auf spanisch und portugisisch in Lateinamerika, wo ebenfalls ein sehr großes Interesse an Psychoanalyse, vor allem der Objektbeziehungspsychologie besteht.
- Hier finden Sie nähere Informationen des Psychosozial-Verlages und können das Buch als Taschenbuch und digital kaufen.
- Hier eine Rezension der Sigmund-Freud-Zentralbuchhandlung.
- Auf dem Blog scharf-links ist eine kurze Rezension zum »Handbuch der Objektbeziehungspsychologie« erschienen.
- Bestellung bei Amazon ist hier möglich.
Klappentext:
Standen in der Psychoanalyse anfänglich Triebkonflikte im Vordergrund, wurden seither die gesamte Fülle menschlicher Wünsche und Bedürfnisse, aber auch Ängste, Scham- und Schuldgefühle in den Blick genommen. Sie haben immer mit dem Anderen zu tun, dem »Objekt«, nach dem die Wünschenden suchen. Die Objektbeziehungspsychologie erweitert die duale Triebtheorie Freuds um eine Fülle zentraler menschlicher Grundbedürfnisse und stellt heute die Hauptströmung der Psychoanalyse dar. Mit dem von Thomas Abel herausgegebenen Handbuch liegt erstmals ein Grundlagenwerk vor, das die wichtigsten Konzepte der Objektbeziehungspsychologie umfassend darstellt. So bietet es einen strukturierten und gut verständlichen Überblick über die wichtigsten Konzepte der modernen Psychoanalyse.