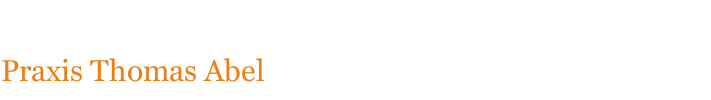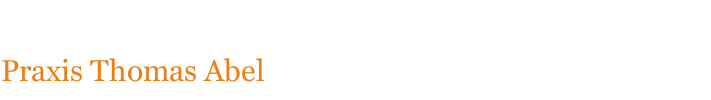Träume und Schlaf
Seit die Menschen denken können, beschäftigen sie ihre Träume. Von alten Geschichtsschreibern wissen wir, dass Medizinmänner, Traumdeuter und Astrologen dafür zuständig waren, die Träume, ganz besonders die der Häuptlinge oder Herrscher zu deuten, wenn die Gemeinschaft vor einer wichtigen Entscheidung stand. Der erste „Schriftsteller“ der Menschheit, der blinde Homer, hat in seinen Geschichten viel davon überliefert. Man sah Träume lange Zeit als Botschaften der Götter an. Erst Aristoteles vertrat die Position, dass Träume den Menschen nicht von außen eingegeben werden, sondern dass es ihre eigenen Schöpfungen sind.
Zum erstenmal therapeutisch genutzt wurden Träume im antiken Griechenland, im Tempel des Heilgottes Asklepios in Epidauros. Dort schliefen Kranke einige Nächte. Ihre Träume, die sie morgens mit den Priestern besprachen, sollen heilende Wirkung gehabt haben. Frauen beispielsweise, die unter sexuellen Problemen oder Unfruchtbarkeit litten erschien im Traum der Heilgott in Gestalt einer Schlange, die sich ihrem Bett näherte und sich den angstvoll erstarrten Träumerinnen warm und freundlich auf den Bauch legte, ohne ihnen etwas zu tun. Dadurch entspannten sie sich und verloren ihre Angst vor der Schlange. Es ist überliefert, dass viele Patientinnen geheilt den Tempel verließen und sich fortan über einen Kindersegen freuen konnten. Deshalb wurde der heilsame Gott Asklepios, lateinisch Äskulap, auch als eine Schlange dargestellt. Bis heute ist die Äskulapschlange das Zeichen des ärztlichen Standes. Wie kann man sich diese wundersamen Heilungen heute erklären? Der Heilgott erschien den Kranken als Schlange, also einem Symbol des männlichen Genitals. Indem sich die Schlange beruhigend auf den Bauch der Träumerin legte, vermittelte ihr der Gott, dass sie keine Angst oder Scheu vor Sexualität haben bräuchte. Diese göttliche Erlaubnis dürfte für die sehr gläubigen Menschen mehr Gewicht besessen haben, als Sexualitätsverbote ihrer Eltern oder ihres eigenen Gewissens.
Im Jahre 1900 veröffentlichte Sigmund Freud sein Buch „Traumdeutung“, mit dem er die Psychoanalyse begründete. Er teilte darin Erkenntnisse mit, die er anhand eigener Träume gewonnen hatte, sowie an Träumen seiner Patienten. Vieles von dem, was er damals beobachtete und intuitiv erahnte, können wir erst seit einem knappen Jahrzehnt dank der modernen Hirnforschung wissenschaftlich belegen und erklären. Zunächst lehnte die Hirnforschung die Erkenntnisse Freuds allerdings ab. Bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts ging sie vielmehr davon aus, dass Träume dadurch zustande kommen, dass nachts Ströme durch die Großhirnrinde wandern und zu rein zufälligen Entladungen von Nervenzellen führen. Je nachdem, was gerade für Inhalte in der jeweiligen Nervenzellstruktur gespeichert wären, setzten sich unsere Träume aus sinnlosen Aneinanderreihungen von Erinnerungen oder Fantasieprodukten zusammen.
Erst in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre gelang es durch immer bessere, bildgebende Verfahren ins Gehirn hinein zu schauen. Eine zunehmende Verbreitung von schlaflabors erbrachte detaillierte Befunde über die Phasen unseres Schlafs. So wissen wir heute, dass während der ganzen Nacht in 90-minütigem Rhythmus 3 verschiedene Schlafphasen einander abwechseln, eine mit geringer, eine mit hoher Schlaftiefe und eine Mittelphase mit schnellen Augenbewegungen, die REM-Phase (REM = rapid eye movement). Das hin und her Bewegen der Augen von rechts nach links und umgekehrt dient vermutlich dazu, beide Hirnhälften zu aktivieren, wodurch eine Integration von sprachlichem Faktenwissen der linken Hirnhälfte und bildhaft-emotionalen Inhalten der rechten Hemisphäre ermöglicht wird. Vor allem in der REM-Phase träumen wir, wahrscheinlich aber auch in den anderen beiden Phasen.
Auch Tierexperimente erbrachten interessante Ergebnisse. In Frankreich hat man beispielsweise bei Katzen einen ganz bestimmten Kern im Gehirn durch eine Elektrode ausgeschaltet, und zwar den, der während eines Traumes dafür sorgt, dass wir die Bewegungen nicht ausführen, die wir träumen. Nachts beobachtete man dann, wie die Katzen aufstanden, die Augen öffneten, jedoch ihr Lieblingsspielzeug völlig ignorierten, zu dem sie am Tag immer hinliefen. Offensichtlich träumten die Katzen. Sie jagten nicht vorhandene Mäuse, fauchten nicht erkennbare Gegner an oder liebkosten unsichtbare Partner. Wir wissen heute, dass fast alle Säugetiere träumen. Die Ereignisse eines Tages speichern wir nicht sofort im Langzeitgedächtnis, sondern erst in einem Zwischenspeicher. Im Traum werden die Erlebnisse eines Tages aus dem „Zwischenspeicher“ geholt, vermutlich dem Hippokampus und ins Langzeitgedächtnis im Neocortex geschrieben. Messungen der Gehirnströme während des Schlafes belegen den regen Austausch zwischen beiden Bereichen. Wozu dient dieses umständliche Verfahren? Das am Tag Erlebte ist nicht nur eine kleine Erkenntnis, sondern eine recht große Datenmenge. Die Katze zum Beispiel muss sich merken, wo und wann und wie sie sich auf die Lauer gelegt hat, dass es erfolgreich ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Weise los zu springen, die Maus so und so zu packen und zu töten. Sie muss sich dabei nicht nur äußere Sinneseindrücke merken, wie Helligkeit, Geruch, Geräusche oder die Windrichtung, sondern auch den gesamten Bewegungsablauf, der sich aus einer komplexen, koordinierten Erregung und Hemmung hunderttausender kleiner Muskelfasern zusammen setzt. Diese Fülle von Informationen wird mit dem verglichen, was bereits gespeichert ist. Die Katze erkennt dann vielleicht, dass sie eine bestimmte Sprungbewegung schon kennt, aber dass sie eine besondere Drehung am Ende neu erfunden hat, dass diese sinnvoll war und deshalb wird sie sie abspeichern. Im Traum spielt sie das Erlebte deshalb noch einmal durch, lässt sich zum Vergleich "Filme" über frühere Sprünge und Drehungen aus dem Speicher des Langzeitgedächtnisses zeigen, vermischt sie, entwirft neue Verknüpfungen und speichert sie ab. Das einzige Säugetier, das nicht träumt, ein australischer Ameisenigel, hat ein verhältnismäßig großes Gehirn. Er muss alles online verarbeiten, d.h. er muss den Trick, wie er gerade Termiten gefangen hat mit dem Langzeitgedächtnis abgleichen und speichern und gleichzeitig fressen, auf Raubtiere und Fressfeinde acht geben. Das verbraucht so viel Hirnkapazität, dass wir Menschen wohl eine Schubkarre mit Gehirn hinter uns her ziehen müssten, wenn wir nicht träumen würden, die Erlebnisverarbeitung also nicht auf die Nacht verlegen könnten.
Zusätzlich zum Tier hat der Mensch eine Fülle sozialer Beziehungen, kultureller Normen und innerer Befindlichkeiten zu verarbeiten. Träume dienen uns dazu, das an einem Tag Erlebte zu verdauen und uns auf Ereignisse der vor uns liegenden Tage vorzubereiten. Manche Menschen erinnern sich nach dem Erwachen nie oder selten an Träume. Das ist so lange nicht besorgniserregend, so lange sie frisch und erholt erwachen. Dann gelingt die Integration des Erlebten ins Gedächtnis auf geräuschlose, unauffällige und erfolgreiche Weise. Wenn wir allerdings immer wieder einmal aus einem Traum erwachen, der sich öfter in immer gleicher oder ähnlicher Art wiederholt, einem sogenannten Wiederholungstraum, gelingt es uns nicht, etwas Wichtiges zu verdauen. In depressiven Krisen kann die Fähigkeit zu träumen sogar zu einem großen Teil verloren gehen. Die Schlafforschung hat bei depressiven Personen sehr veränderte Schlafphasen gemessen. Der Schlaf war weniger tief und zeigte deutlich verkürzte REM-Phasen. Die Betroffenen versuchen dann durch manchmal stundenlange, fruchtlose Grübeleien, bevorzugt auch in den Abend- und Nachtstunden, die Probleme zu lösen und die Erfahrungen zu verarbeiten, die sie eigentlich im Schlaf träumend bewältigen sollten. Das geschieht vor allem dann, wenn uns eine Lebenssituation so schwierig oder ein Ereignis so schmerzlich erscheint, dass wir unbewusst befürchten, es nicht verarbeiten zu können oder wenn wir Angst davor haben, uns dem Problem und den damit verknüpften starken Gefühlen auszusetzen, und sei es im Traum. In diesen Fällen verzichtet ein Mensch ganz aufs träumen, entbehrt dadurch aber auch der Chance, wichtige Erfahrungen zu verarbeiten. Meist geht es jedoch weniger dramatisch zu. Zu schmerzliche oder zu unangenehme Erlebnisse werden dann nicht direkt geträumt, sondern in verhüllter Form auf die innere Bühne gebracht. Gleiches gilt für Bedürfnisse oder Wünsche, die uns unser Gewissen und unsere Moralvorstellungen verbieten, zum Beispiel sexuelle Wünsche, Machtstreben, boshafte, aggressive oder neidische Impulse unsern Liebsten gegenüber etc. All diese Dinge werden im Traum getarnt, damit wir nicht vor Schreck über uns selbst erwachen. Schließlich muss der Traum auch zu mancherlei Gestaltungsmitteln greifen, um komplexes, aber nicht sinnlich wahrnehmbares Erleben zu veranschaulichen. Zum Beispiel träumen wir vielleicht davon, zu fliegen und abzustürzen, wenn wir einen Absturz unseres Selbstwertgefühles erlebt haben oder befürchten. Oder wir träumen davon, einen Zug zu verpassen, wenn wir meinen, uns sei eine gute Gelegenheit entgangen. Freud und seine Mitarbeiter, wie etwa Alfred Adler haben zahlreiche solcher Mechanismen beschrieben. Sie erschweren es dem Laien bisweilen, Geträumtes zu verstehen.
Einen festgelegten „Bedeutungskatalog“ für Traumsymbole gibt es allerdings in der seriösen Psychotherapie nicht, weil jeder Mensch seine Konflikte auf eine ganz eigene Weise be- und verarbeitet. Entscheidend ist, was dem Träumer selbst zu den einzelnen Teilen seines Traumes einfällt und ob ihm diese Einfälle zu neuen Erkenntnissen über sich selbst verhelfen. Träume können uns anregen, einmal ganz anders über uns nachzudenken, und sie können uns, gerade in Gestalt von Wiederholungsträumen eindringlich mahnen, dass es da etwas Wichtiges, aber noch Unverdautes in uns gibt. Oder wie heißt es so treffend im Talmud, der heiligen Schrift der Juden: ein unverstandener Traum gleicht einem ungelesenen Brief. Wir würden heute vielleicht ergänzen: einem ungelesenen Brief von uns selbst